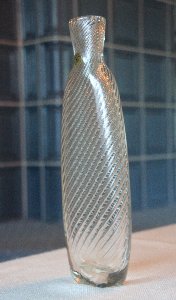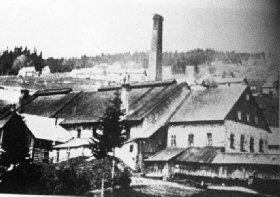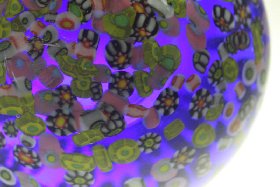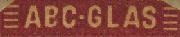







Home
Glossar
Fotos © Copyright:
O. Rapp
|
|
Glossar
Glas und Glasperlen
- deutsche Termini - |
 |
|
|
|
|||
| Achatglas:
farbig gebändertes Glas, das den Halbedelstein Achat imitieren soll. |
|||
| Annagelb: Farbe des gelblich getönten Uranglases, von Josef Riedel nach seiner Frau benannt. | Annagrün:
Farbe des grünlich getönten Uranglases, von Josef
Riedel nach seiner
Frau benannt. |
||
| Antimon: ergibt als
Beimischung zum
Gemenge gelbgetöntes Glas.
|
Aventuringlas: Glas mit eingeschlossenen Kupferflittern. | ||
| Beinglas: durch Zusatz von Knochenasche erzeugtes opakweißes Glas. | Bissel: Halbfertigprodukt für die Herstellung von Coupé-, Schmelz- und Rocaillesperlen, das gewonnen wird in dem hohle Stengel in kleine Teilchen (Hackebissel), geschnitten oder gesprengt (Sprengperle) werden. | ||
| Bleikristallglas:
Bei der B. genannten Sorte Glas ersetzt man die lange
üblichen Erdalkalien wie Calciumoxid durch Bleioxid. Der Anteil für
echtes Bleikristallglas muss dabei mindestens 24 % betragen.
Geschliffenes Bleiglas wird oft auch als Bleikristall bezeichnet.
Bleikristallglas ist auch in dickwandigen Gefäßen klar und lässt sich
gut schleifen.
|
Bornl: tropfenförmige Perle mit wabenförmigen Facetten und runder Grundform. | ||
| Braunstein, eisenhaltiger: ergibt als Beimischung zum Gemenge violettgetöntes bis schwarzgetöntes Glas. | |||
| Chamäleonglas: siehe Lithyalinglas. | Charlotte: sehr kleine
Rocailleperle. |
||
| Coupéperle: ein hohles Glasstengelchen wird zuerst mit der Maschine - früher mit der Handrade - in kleine Teilchen (Bissel) zerschnitten, worauf dann die Rondierung und Abschmelzung dieser Teilchen erfolgt. Die Dekorierung der Schmelzperle geschieht dadurch, dass sie mit einem Luster oder mit dem sogenannten "Iris" in Zinnsalzdämpfen überzogen wird. | |||
| Dekorierung des
fertigen Glases: kann in heißem und kaltem Zustand
erfolgen. Ist
die Glasmasse noch warm, kann sie mit Holzstäben, Streich- und
Zwackeisen gedellt, gekniffen, gewellt werden; mit Wasser kann sie
abgeschreckt werden (Eisglas), so dass sie an der Oberfläche wie
gebrochenes Eis aussieht; farblose oder farbige Glasfäden können
aufgeschmolzen werden. Durch Dämpfe kann die Oberfläche chemisch
verändert werden. In kaltem Zustand kann Glas mit farbiger Email-,
Lack-, Schwarzlot-, Gold und Silbermalerei verziert werden. Außerdem
kann es geschliffen, geschnitten, punktiert, gerissen und geätzt werden. |
Diamantine: Glasdiamantine. | ||
| Diamantriss: Mit einem
Diamanten,
der einem griffelähnlichem Werkzeug vorn eingesetzt ist, werden dem
Glas Muster eingeritzt. |
Doppelschmelz: zweimal
polierte
Perle. |
||
| drücken: herstellen von
zumeist
kleineren Glasobjekten, indem halbflüssige Glasmasse in eine Stahl-
oder Nickelform gepresst wird. |
Drücker (Dialektbez. Dröker):
Sammelbezeichnung für Arbeiter, die die verschiedenen Formen des
Glasdrückens (Lampendruck bzw. Ofendruck) ausüben. |
||
| Druckhütte: Werkstatt,
in der
mindestens ein Arbeitsplatz an einem Druckofen vorhanden ist. Die
Bezeichnung wird in Abgrenzung zur (Glas-) Hütte verwendet. Dort, wo
keine Glashütte am Ort ist, auch einfach als "Hütte" bezeichnet. |
Druckperle: wird in
ähnlicher Weise
wie die Knöpfe aus dem massiven Glasstengel gedrückt, wobei zugleich
ein Fädelloch gestochen wird. |
||
| Druckstange: Stangenglas,
von dem
mittels Druckzange Perlen, Knöpfe etc. abgedrückt werden. |
|||
| Echtgoldperle:
Hohlperle aus Kristallglas geblasen und dann an der Innenseite
mit
einem Überzug (Spiegel) aus echtem Gold versehen. |
Einmalen: Technik des
Farbauftrags
auf der Innenwand von Hohlperlen bzw. Bisserl. |
||
| Einmalperle: Hohlperlen bzw.
Bisserl, die von innen mit Farbe eingemalt sind. |
Einzieher: färbt Glasröhren
durch
Einziehen von Farbe oder metallischen Lösungen (meist Silber). |
||
| Eisenoxid: ergibt als
Beimischung
zum Gemenge Glas in hellem Gelb, Grün oder Braunrot. |
Eisglas: unmittelbar nach
der
Formgebung abgeschrecktes oder in feinen Glassplittern gewälztes Glas,
das vielfach geborstenem Eis ähnelt. |
||
| Emailbemaltes Glas: Emailfarben
bestehen aus Farbkörpern (Metallen oder Metalloxyden) und einem
Flussmittel (Quarz oder Pottasche). Diese werden zerrieben und mit
einem Bindemittel angedickt. |
|||
| Facettieren: dekorativer,
meist geometrischer Oberflächenschliff. |
Fadendekor: vorwiegend zwei
Ausführungen: 1. fein "wie ein Faden" ausgezogenes Glas wird um die Glaswandung (Bauch, Hals oder Öffnungsrand) als Dekor oder zur Verstärkung gelegt. 2. weiße oder farbige Glasfäden werden ggf. netzartig in eine durchsichtige Glasmasse eingebettet. "Filigrangläser" sind seit dem 16. Jahrhundert bekannt. |
||
| Feather Bead: spitzig
auslaufende
olivenförmige Lampenperle. Auf den monochromen Korpus wird ein dünner
Glasfaden aufgelegt und mit einem kammähnlichen Werkzeug verzogen, so
dass mehrere parallele, leicht geschwungene Linien entstehen, die wie
Blattrispen oder Federäste aussehen. |
Feuerpolieren: Polieren
durch
Erhitzen im Feuer (Schmelz). |
||
| Filigranglas: Entseht durch
Einbetten von Glasfäden in die Glasmasse (bekannt seit dem 16.
Jahrhundert). |
Flissl: (mundartl. Gablonz)
facettierte, im Seitenstich längs gestochene Schmucksteine. |
||
| Gebindl: (mundartl.
Ganblonz) Lieferform für Stangenglas, ca
20 kg, Stengl mit
gedrehtem Strohseil zusammengebunden. |
Gemenge: Gemisch zum
Glasschmelzen,
bzw. die Rezeptur des Gemisches. |
||
| Gelbbeize: Massives
transparentes Gelb ist eine Problemfarbe beim Glas und gelang nur
selten. Seit etwa 1810 nutzte man ein Verfahren in der
Hohlglasveredelung, bei dem der Maler Silberoxyd oder -chlorid mit
einer neutralen Trägersubstanz (z.B. rotem Ocker) zu feinem Pulver
zerreibt. Den mit Wasser angerührten Brei streicht man mit dem Pinsel
gleichmäßig (damit keine Flecken entstehen) auf das Hohlglas oder Teile
davon. Nach dem Trocknen "brennt" er das Glas im Muffelofen,
lässt es abkühlen und bürstet die trockene Breischicht ab. Darunter
kommt gelbes Glas zum Vorschein. Siehe auch "Rubin- oder Rotätze". |
|||
| Geschmirgelte Perle: gedrückte Perle aus einer fein geschmirgelten Druckform, so dass eine glänzende Oberfläche entsteht. | Glasdiamantine: Glasflitter, Glasstaub. | ||
| Glasdrücker: siehe "Drücker". |
Glasfluß oder Glaspaste: Leicht flüssiges bleireiches Kaliglas, das mit Metalloxyden gefärbt ist. | ||
| Glasformung: Für "in Form"
geblasenes oder gepresstes Glas benutzt man zwei- oder mehrteilige
Negativformen, die aus gebranntem Ton, Holz oder Metall bestehen
können. Nach Erkalten und Entformen des Glases setzt man dem Gefäß
Henkel, Füße und evtl. Dekorierungen an (vgl. auch "Dekorierung"). |
Glasposten: Glasmenge, die
zur
Formgebung aus dem "Hafen" entnommen wird. |
||
| Glassatz: vgl. "Gemenge". |
Glasstengel:
Halbfertigprodukt für
die Herstellung von "Bissel". |
||
| Goldlösung: ergibt als
Beimischung
zum "Gemenge" rubinrotes Glas. |
Goldmalerei: Der Glaswandung
kann
Gold aufgetragen werden. 1. auf "kaltem" Wege (d.h. ohne Erhitzung) in Form von Blattgold auf Bindemitteln /Firnis, Leim) oder vergoldeten Emailfarben, die als Relief aufliegen. Nach Auftrag wird der Golddekor mit einem Achat poliert. 2. durch sog. "Feuervergoldung", bei der mit Terpentin oder Öl angeriebenes Goldpulver oder eine Lösung von Schwefelgold und -balsam eingebrannt werden. Letztere ergibt bereits nach dem Brand ohne Polierung einen Hochglanz. Um die Haltbarkeit der Goldmalerei zu erhöhen, kann sie mit einer Lack- oder Glasschicht überzogen werden.  Parfümflasche handgeschliffen mit Gelbbeize und Goldbemalung Design: Franz Burkert, Kristallglas GmbH (Rohglas: Hessenglas) |
||
| Gravur: siehe Schnitt. |
Gürtlerei: Im Kontext der Gablonzer Industrie die Erzeugung von Bijouteriewaren. Allgemein bezeichnet G. die Verarbeitung von Werkstoffen wie Messing, Kupfer oder Aluminium zu Schmuck, Kleidungsacessoires (Gürtelschnallen), Lampen, Möbel und Industrieteilen. 1998 zählt die G. zum Berufsbild des Metallbildners. | ||
| Hackebissel: kleine Stifte bzw. Perlen, die durch Hacken von dünnen Glasröhren gefertigt werden (vgl. auch "Bissel"). | Hafen: Ton- oder
Schamottgefäß im
Glasofen, in dem die flüssige Glasmasse gewonnen wird bzw. zur
Bearbeitung flüssig gehalten wird. |
||
| Handrade: dient dem
manuellen
Schneiden der "Bissel" aus den Glasstängelchen. |
Heliolit-Glas: Glasfarbe aus seltenen Erden
geschmolzen. Farbgebend ist das Praseodymoxid; Helilolit hat die
Eigenschaft, je nach Lichttemperatur die Farbe von "feurig leuchtend
apricot" (Hessenglas) bzw. "sandfarben" (Moser) zu grün zu wechseln. Brüder im Geiste sind die seltenen Alexandrit- und Royalit-Gläser, die ebenfalls von den Hessenglaswerken hergestellt wurden. |
||
| Hohlglas: Mit dem Mund geblasenes oder maschinell hergestelltes Glas, das Hohlformen bildet. | Hohlschnürltechnik: Hergestellt
wird eine zylindrische Form, welche vom Boden her mit freistehenden
Stahlstiften versehen ist. Die Stifte müssen gerade soweit voneinander
entfernt liegen, dass sich beim Einblasen des Innenglases dieses gerade
noch an den äusseren Glaszylinder anblasen kann. Ein vorgefertigter
Glaszylinder wird in Kühltemperatur zwischen die Außenwandung der
Stahlform und den freistehenden Stiften eingelegt. Anschließend
wird das (Hohl)Glas in den ganzen Holhlraum so fest eingeblasen, dass
dieses, die stehenden Stifte umschließend, sich gerade noch an
den vorgefertigten Glaszylinder anbläst. Sodann wird entweder das ganze
Glasstück, jetzt doppelwandig mit hohlen Zwischenräumen, aus der Form
gezogen und im Ofen oder einer Trommel gewärmt. Der Glaszylinder und
die innere Form werden zusammen verschlossen. Von diesem Zeitpunkt an
sind die Hohlräume verschlossen und es kann weiteres Glas zur weiteren
Formgebung aufgenommen oder eingeblasen werden. Vase
mit Hohlschnürltechnik
Design: Prof. Aloys F. Gangkofner Hessen-Glaswerke, Oberursel |
||
| Hüttentechniken: Alle Verfahren der Formgebung am heißen Glas, also vor dem Ofen. | Hyalithglas: (griechisch: hyalos = Glas) Fast schwarz wirkendes, tief dunkelfarbiges sog. Steinglas, mit dem Halbedelsteine nachgeahmt werden sollten. Es enthält Zusätze von Lava, Basalt, Hochofenschlacke und Metalloxyden, | ||
| Irisierung: metallische
Beschichtung der Glasoberfäche durch Aufdampfen von Metallsalzen oder
-oxyden. |
Jadeglas:
siehe Opalglas |
||
| Kalknatronglas:
älteste Glasart (Kieselsäure, Kalk und als
Flussmittel Natron oder
Soda). |
Kaltbemaltes Glas: mit Lack-
und
Ölfarben bemaltes Glas, wenig haltbar, selten verwendet. |
||
| Kappl: zweiteilige
Metallform (obere
und niedere K.) im Glasdruck. |
Kelchglas: Weinglas ähnlich einem Pokal, nur mit meist spitz heruntergezogener "Kuppa" und ohne Deckel. | ||
| Kernl: eine von oben
gestochene
runde Perle. |
Kletzl: walzenförmige, im
Seitenstich längs gestochene Perle. |
||
| Knochenasche: ergibt als
Beimischung
zum Gemenge bzw. Glasschmelz eine weiße Trübung des Glases. |
Kobalt: ergibt Beimischung
zum
Gemenge blaugetöntes Glas. |
||
| Komposit oder Kompositglas: Spezialgläser,
die sich durch besondere Farben oder andere Materialeigenschaften
auszeichnen. Sie werden in speziellen kleinen Glashafen erschmolzen,
die nach oben geschlossen sind, um Verunreinigungen zu vermeiden. |
Kristallglas: gewinnt man
durch
Zusatz von Bleioxyd (Mennige) zur Glasmasse. Eignet sich gut für
Schliff, Schnitt und Diamantriss. Seit dem 17. Jahrhundert besonders in
Böhmen produziert. |
||
| Kugler: Hohlglasveredler /
Hohlglasfeinschleifer. |
Kupfer: ergibt als Beimischung zum Gemenge Glas in einem opaken Blutrot. | ||
| Kupferoxyd: ergibt als Beimischung zum Gemenge blaugetöntes Glas. | Kuppa: (lat. cuppa = Kopf) Oberer Teil eines Trinkglases, der von Stiel und Fuß getragen wird. | ||
| Lampe: Bis
Ende des 19. Jh. ein mit Talg, Brennöl oder Petroleum gefeuerter
kleiner Tischbrenner. Seit Ende des 19. Jh. hat sich die Gasbefeuerung
durchgesetzt. |
Lampendruck: Technik, bei der
über
der Lampe dünne Glasstengel erhitzt und in Metallformen gepresset
werden. |
||
| Lampendrücker: Arbeiter, der
(meist
in Heimarbeit) über der Lampe dünne Glasstengel erhitzt und in
Metallformen presst. |
Laufgang: meist hölzerner
Anbau an
eine Glashütte, in dem Stangenglas freihändig ausgezogen wird. |
||
| Lithyalinglas: ein in der
Masse
marmoriertes Glas, das halbedelsteine imitieren soll. 1828 von Fridrich
Egermann (1777-1864) erfunden, der es auch Chamäleonglas nannte, wegen
vielfältiger Möglichkeit der Variierung von Farben und Tönen, besonders
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Gebrauch. |
|||
| Metallisierte
Hohlperle: eine frei oder in Form geblasene, innen mit
einem
Überzug von salpetersaurem Silber versehene Perle. Die metallisierte
Hohlperle wird aus farbigen, seltener aus weißen Glasstengelchen
hergestellt und mit einem Silbereinzug versehen. Nur auf diese
Perlensorte bezieht sich die Produktivgenossenschaft der
Hohlperlenerzeuger in Gablonz. |
Milchglas: opak weißes Glas,
das
durch Zusatz von Zinnoxyd erzeugt wird. Als Porzellanersatz vor allem
im 18. Jh. beliebt. |
||
| Millefiori: (ital. = Tausend
Blumen)
Glasdekorationstechnik, bei der Glasstangel in Bündel zu einem Stab
zusammengeschmolzen und nach Erkalten in Scheiben geschnitten und in
einer (meist farbigen) Glasmasse eingeschmolzen werden. |
Muffelofen: Als Muffelofen
oder Muffel wird seit dem 18. Jahrhundert auch ein speziell für
den Farbbrand von Aufglasurfarben konstruierter Ofen bezeichnet, bei
dem die Brandgase („der Rauch“) und die aufgewirbelte Asche aus der
Brennkammer nicht in Berührung mit dem Glas kommen
können, sondern außen, entlang der abgedichteten Wände einer getrennten
Brandgutkammer und schließlich durch einen Abzug abziehen. Diese Kammer
wird durch die Wände hindurch auf bis zu 800 °C erhitzt, so dass
die Aufglasurfarben – auch Muffelfarben genannt – in das Glas
einsinken. Ein gesonderter Abzug auf der Oberseite lässt die Dämpfe der
Farb- und Lösungsstoffe aus dieser Kammer entweichen.
|
||
| Nodus:
(lat. =
Knoten). Verdickung des Pokal- oder Kelchglasstiels, die dazu dient,
das Gefäß besser halten zu können. |
|||
| Oertel:
siehe
Radstuhl. |
Oertelpacht: in der Regel
verpachtete der Schleifmühlenbesitzer die einzelnen Arbeitsplätze mit
Schleifsteinen (Oertel) an die Schleifer. |
||
| Ofendrücker: Arbeiter, der
zur
Erhitzung der Druckstange einen Druckofen verwendet. |
opak: undurchsichtig |
||
| Opalglas: opakes durch Zusatz
von
Fluorverbindungen erzeugtes Glas. Sie können bei unterschiedlichen
Temperaturen oder Temperaturbehandlungen ihre Opazität bis zur
partiellen oder kompletten Transparenz verlieren, behalten aber ihren
Farbton. Typisches Beispiel dieser Eigenschaften sind die Jade- und
Lapisjugendstilgläser der Firmen Josef Riedel in Unterpolaun, Carl
Riedel in Josefsthal sowie die Hyalith- und Lithyalingläser von
Friedrich Egermann in Bottendorf bei Haida. |
»Optisch« geblasenes Glas: Das
Glas
wird in einer gerillten oder gewellten Form vorgeblasen und dann "frei"
fertig geblasen. Dabei passen sich die Oberflächenstrukturen der Form
an. |
||
| Paterlein: etymologisch von
Rosenkranzperle (pater noster) abgeleitet, bezeichnet Perlen allgemein. |
|
||
| Pressglas: industriell
hergestelltes Glas. Die Glasmasse wird in Metallformen eingepresst,
wobei sich das Negativrelief der Pressform als Positiv auf der
Glasoberfläche eindrückt. In Deutschland seit 1850 weit verbreitet. |
Punktieren: Mit einer
Radiernadel
werden kleine, zu Mustern oder Bildern geordnete Punkte auf die
Glaswandung eingehämmert oder gestippt. |
||
| Quetscher: Arbeiter, der das Schließen und Öffnen der Formzange besorgt; vgl. auch "Ofendrücker". | |||
| Radstuhl: (=
Oertel) Arbeitsplatz mit wasserbetriebenem Schleifstein. |
Redlhammerperle: in einem
maschinellen Pressverfahren aus einer porzellanartigen opaken Masse
gefertigte Perlen. |
||
| retikuliertes Glas: Glas mit
einem
netzartigen Muster. |
Rocaillesperle: maschinell
erzeugte
Sprengperle, meist sind nur die Schmelzperlen kleinerer Größe gemeint. |
||
| Römer: Bezeichnung, die
vermutlich
zuerst in Köln geprägt wurde. Sie bezog sich zunächst auf die
nachgeahmten römischen Gefäße, die man von 15./16. Jh. an in diesem
Gebiet reichlich fand. Man versteht darunter ein Trinkglas mit sich
verjüngendem Hohlfuß, der in einem Hohlschaft übergeht, auf dem eine
kleine kugelige Kuppe sitzt, deren Rand eingezogen ist. Je nach Gegend
ändern sich die Proportionen von Fuß, Schaft und Kelch. Aus diesen kann
man Rückschlüsse auf zeitliche und örtliche Entstehung ableiten. |
Rondieren: alte
venezianische
Technik, bei der in einer Pfanne oder Trommel unter Hitze
(Feuerpolieren) eine glänzende Oberfäche erzeugt wird. |
||
| Royalit-Glas: Glasfarbe
aus seltenen Erden
geschmolzen. Farbgebend ist das Neodymoxid in Verbindung mit
Selen. Royalit hat die
Eigenschaft, je nach Lichttemperatur die Farbe von "rot-violett" zu
grau zu wechseln. Die Farbveränderung ist dabei weniger stark
ausgeprägt als bei den Alexandrit- und Heliolit-Gläsern. |
|||
| Rubin- oder Rotätze: neben der Gelbbeize gibt es die R., ein Verfahren in der Hohlglasveredelung, bei dem der Maler Kupfer mit einer neutralen Trägersubstanz (z.B. rotem Ocker) zu feinem Pulver zerreibt. Den mit Wasser angerührten Brei streicht man mit dem Pinsel gleichmäßig (damit keine Flecken entstehen) auf das Hohlglas oder Teile davon. Nach dem Trocknen "brennt" er das Glas im Muffelofen. Beim ersten Brand färbt sich das Glas grün. Beim zweiten (diesmal reduzierten) Brand verwandelt sich das Oxyd in Metall und erzeugt auf dem Glas die rubinrote Farbe als hauchdünne Schicht. Erfinder des Verfahrens war Friedrich Egermann im nordböhmischen Haida. | Rubinglas: durch Gold- oder
Kupferzusatz gefärbtes Glas. |
||
| Säurepolitur: Poliertechnik
im Säurebad, die bei Glasoberflächen
mit Musterschliff
bzw. -schnitt angewandt wird. Die verwendeten Säuren variieren je nach
Härtegrad des Glases (bspw. Kristallglas oder Bleikristall, etc.). |
Schinden: Arbeit der Hüttenarbeiter in den Pausen auf eigene Rechnung. Typische Objekte sind figürliche Glasarbeiten. | ||
| Schliff: Dekorierungstechnik, durch die größere Glasstücke aus dem fertigen Glasgefäß geschliffen werden. Dabei wird das Glas mit der Hand frei gegen die rotierende größere Eisenscheibe (sog. Zeug) gehalten. | Schleifen: Glätten der unebenen Stellen der Glasoberfläche. Als Schleifpulver dient Schmirgel. | ||
| Schmalte: Kobaltschmelze zum Blaufärben von Gläsern. | Schmelz: 1. bei der Glasformung das erweichte formbare Glas. 2. die Produktgruppe der Schmelzperlen. | ||
| Schmelzperle: vgl.
Coupéperle. |
Schnitt: (= Gravur) Ähnlicher Vorgang wie beim Schliff. Das Glasobjekt wird aber gegen eine kleinere rotierende Kupferscheibe gehalten. Es entstehen feinere Dekorierungen als bei dem Schliff. | ||
| Schürer: Arbeiter, der für
das
Schüren - die Unterhaltung des Feuers - der Schmelzöfen zuständig ist. |
Schwarzlot, Schwarzlotmalerei: Mit
gebranntem Kupfer versetztes leichtflüssiges Bleiglas. Seine Farbe
variiert zwischen dunklem und hellem Braunschwarz. Mit dieser Masse
wird das Glas bemalt, dunklere und hellere Partien werden durch
Radieren herausgearbeitet und dann dem Glas im Brennofen aufgeschmolzen. |
||
| Silberglas (Bauernsilber): Hohlgefäße, die auf der Innenseite versilbert werden. Ab etwa 1880/90 verstärkt hergestellt, vorallem in Böhmen. | Sprengperle: wird gewonnen, indem Glasröhren am Sprengzeug in kleine Bissel (Stücke) gesprengt werden. Dazu wird die Glasröhre mit einer Stahlscheibe, Feile oder Diamant angeritzt und anschließend mit einem kalten Gegenstand berührt, so dass sie dort, wo sie geritzt ist, bricht. | ||
| Stangenglas: Sammelbegriff
für
Rohglas in Stangenform. |
Stengl: Einz einzelnes Stangenglas als Rohmaterial zur Arbeit am Drückofen. | ||
| Technisches Glas:
Für Lampen, Kfz- und Flugzeugindustrie, Kolben,
Röhren und anderes
Laborgerät. |
Temperofen: Ofen in dem die
Werkstücke nach der Formgebung langsam abkühlen können. Bei einfachen
Öfen des 19. Jh. oft eine Kammer an, bzw. in der Außenwand des
Schmelzofens (Abkühlhafen). Heutige Temperöfen erlauben eine
elektronische Regulierung mit einem langsamen absenken der Temperatur. |
||
| transluzid:
durchscheinend |
transparent:
durchsichtig |
||
| Überfangglas: ein
Ü. besteht aus einer farbigen Außenwand, die
über einer inneren
farblosen liegt oder umgekehrt. Überfangglas ist meist geschliffen. |
Uranglas wurde vermutlich
von Josef
Riedel in Nordböhmen erfunden, der zwei Arten dieses Glases mit dem
Namen seiner Frau benannt hat (vgl. Annagelb und Annagrün). Das
früheste datierte Glas aus Uranglas trägt die Jahreszahl 1834 und
befindet sich in der Sammlung Lesser in Karlsruhe. |
||
| Waldglas:
durch eisenhaltige Rohstoffe grünlich oder bräunlich gefärbtes Glas,
das oft auch Spuren von Verunreinigungen erkennen lässt. |
Wannenöfen (Wanne): Meist
großvolumige Glasöfen der industriellen Massenproduktion, unterteilt in
Schmelzwanne und die Arbeitswanne mit Entnahmezone mit manueller oder
mechanisierter bzw. automatisierter Entnahme mittels Speisevorrichtung
zur weiteren Verarbeitung. Der Vorteil der gegen die aggressive
Schmelze hervorragend ausgekleideten Wannenöfen liegt darin, dass sie
gegenüber den herkömmlichen Hafenöfen eine kontinuierliche Produktion
in großen Stückzahlen ermöglichen, weil sie nahezu ununterbrochen in
Betrieb bleiben. |
||
| Zinnasche
(Zinnoxyd): ergibt als Beimischung zum Gemenge bzw. Glasschmelz eine
weiße Trübung. |
Zinnpolieren: Polieren von
Glas mit
Flächenschliff auf einer Zinnscheibe. |
||
| Zwinkerschere: aus einem
Stück
gearbeitete, metallene Schere zum Abtrennen und Formen der
aufgenommenen Glasmasse. |
|||
Fotos © Copyright: O. Rapp Quellen: Dönch, Udo: Das Stangenglas und seine Weiterverarbeitung, Zwiesel 1972 Gangkofner, Ilsebill: Aloys F. Gangkofner - Glas und Licht -, Prestel Verlag München 2009 Museum für Kunsthandwerk Frankfurt am Main, Europäisches und Außereuropäisches Glas, Frankfurt 1973 Nachtigall, Walter u.a.: Glas, Verlag der Wirtschaft, Berlin 1988 Spiegel, Walter: Farbenglas und Überfang, Antiquitätenzeitung 2005 Nr. 13 Vierke, Ulf: Die Spur der Glasperlen, Bayreuth 2006 |
|||